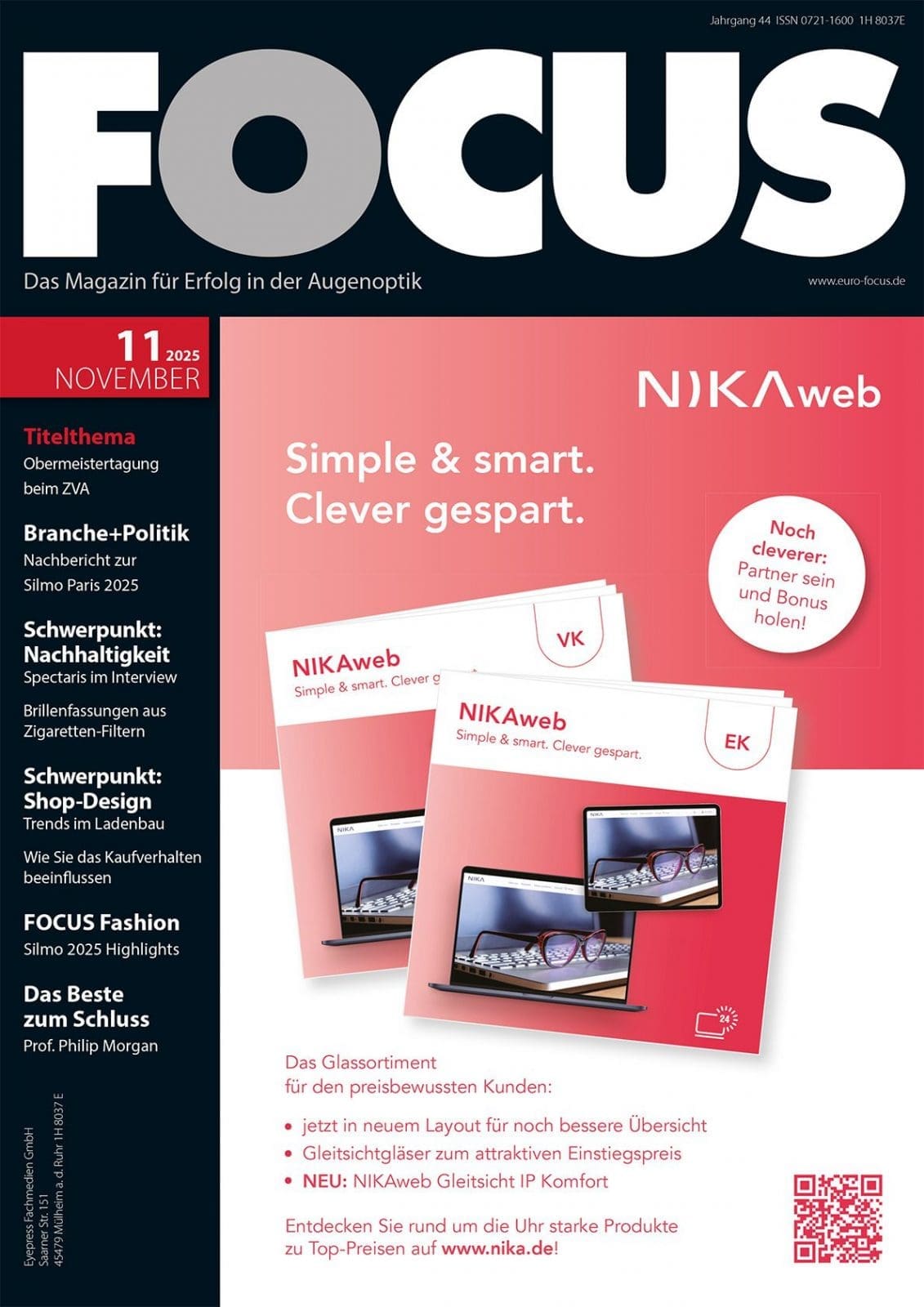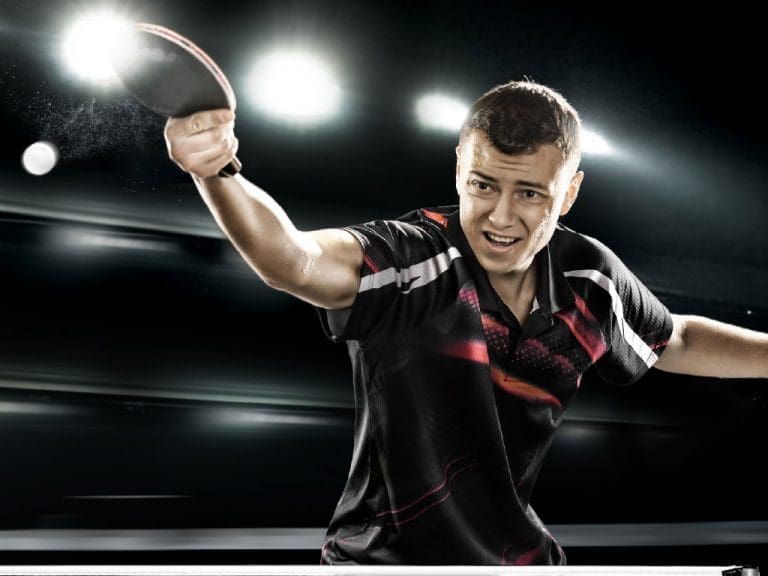Twilight – Zwischen Tag und Nacht

Die Physiologie des Dämmerungssehens
Stellen Sie sich vor, es ist Sommer, die Sonne versinkt am Horizont, der Himmel färbt sich in ein dunkles Rosa, und die Welt beginnt, ihre Farben zu verlieren. Rottöne verblassen, während Blau- und Grautöne dominieren – als würde sich die Umgebung neu ordnen. Genau in dieser Zwischenzeit, wenn Tag und Nacht ineinander übergehen, geraten unsere Augen an ihre Grenzen: Konturen verschwimmen, Bewegungen wirken unscharf, Entfernungen sind schwerer einzuschätzen. Für uns Menschen, die auf Tageslicht ausgelegt sind, ist die Dämmerung eine Herausforderung. Unser Gehirn muss blitzschnell vom farbstarken Sehen am Tag auf das lichtempfindliche Nachtsehen umschalten – ein wahrer Balanceakt, der nicht selten über die Sicherheit im Alltag entscheidet.
Das Dämmerungssehen, auch als mesopisches Sehen bezeichnet, beschreibt die visuelle Wahrnehmung in Lichtverhältnissen zwischen Tag und Nacht. Es wird hauptsächlich durch die Stäbchen der Netzhaut vermittelt, die besonders empfindlich auf geringe Lichtintensitäten reagieren. Im Gegensatz dazu sind die Zapfen für das Sehen bei Tageslicht verantwortlich. Mit zunehmender Dunkelheit nimmt die Sehschärfe ab, während die Fähigkeit, Kontraste wahrzunehmen, steigt. Wie hell ein Bereich, sei es Straße, Raum oder Tasche, ausgeleuchtet wird, wird durch die Beleuchtungsstärke beschrieben. Die dazugehörige SI-Einheit heißt Lux, lateinisch für Licht.
Wenn das Licht schwindet
Am Tag wird die Retina von intensivem Licht stimuliert: Zapfen in der Netzhaut sind dominant aktiv und ermöglichen scharfes Sehen und die Wahrnehmung von Farben. Die Beleuchtungsstärke erreicht Werte von mehreren zehntausend Lux, Kontraste sind klar, Bewegungen präzise wahrnehmbar. Mit abnehmender Sonneneinstrahlung reduziert sich die Intensität des Lichtes exponentiell – die Dämmerung beginnt. In dieser Phase nimmt die Aktivität der Zapfen ab, während die lichtempfindlichen Stäbchen, welche für das Hell-Dunkel-Sehen zuständig sind, allmählich die visuelle Dominanz übernehmen. In diesem Zusammenhang wird der Sehfarbstoff Rhodopsin (Sehpurpur) aktiviert und leitet anschließende Reaktionen ein. Die Farben werden weniger intensiv wahrgenommen, der Purkinje-Effekt (siehe unten) verändert die relative Helligkeit von Blau- und Rottönen, und die Sehschärfe sinkt. Rot erscheint in der Dämmerung im Vergleich zum Sehen am Tage beispielsweise weniger satt und sogar dunkler, wohingegen grün oder blau, dank gesteigerter Aktivität der Stäbchen, heller wirken (siehe Abbildung 1b).
Im Vergleich: Die Retina besitzt rund 6 Millionen Zapfen, die vor allem in der Fovea centralis lokalisiert sind und ungefähr 120 Millionen Stäbchen, welche auch in der Peripherie der Netzhaut zu finden sind. Aus diesem Grund entsteht in der Nacht ein Skotom im Bereich der Fovea centralis.
Wenn die Dunkelheit einsetzt, arbeiten ausschließlich die Stäbchen: Das skotopische Sehen ermöglicht noch die Wahrnehmung von Formen und Bewegungen bei minimalem Licht, jedoch nahezu ohne Farbinformation, wie in Abbildung 1c erkennbar ist. Dieser Übergang vom photopischen über mesopisches zum skotopischen Sehen ist ein komplexer physiologischer Anpassungsprozess, der sowohl Evolution als auch moderne Sicherheitsaspekte im Alltag beeinflusst.
Abbildung 1: Graphische Darstellung des Purkinje-Effektes – a) Farbwahrnehmung bei Tageslicht b) Entsättigung/Farbverschiebung bei Dämmerung
c) graue Farbwahrnehmung bei Nacht
Die unsichtbare Anpassung
Die Dunkeladaptation verläuft dabei in zwei verschiedenen Phasen (Sofort- und Daueradaption): Zunächst reagieren die Zapfen bei der Sofortreaktion schnell auf die veränderten Lichtverhältnisse – innerhalb einer Minute steigt ihre Empfindlichkeit deutlich an, Farben bleiben noch erkennbar. Nach etwa zehn Minuten übernehmen die lichtempfindlicheren Stäbchen in der Daueradaption. Diese ermöglichen zwar besseres Sehen im Dunkeln, aber kein Farbsehen mehr – daher erscheinen Farben nun grau. Nach rund 30 Minuten wird die maximale Empfindlichkeit im Dunkeln erreicht.
Der Purkinje-Effekt
Der Purkinje-Effekt, auch Purkinje-Verschiebung genannt und 1819 von dem Physiologen Jan Evangelista Purkyně entdeckt, beschreibt die verschobene Farbempfindlichkeit des menschlichen Auges durch Veränderungen der Lichtverhältnisse. Sie beruht auf den unterschiedlichen spektralen Empfindlichkeitsmaxima der Sehzellen (Stäbchen und Zapfen) beim Tag- und Nachtsehen. Das Empfindlichkeitsmaximum der L-Zapfen bzw. der Rotrezeptor liegt bei ca. 560 nm, das des M-Zapfens, auch als Grünrezeptor bekannt, liegt bei rund 534 nm. Der S-Zapfen (Blaurezeptor), welcher in der Retina im Vergleich zu den beiden anderen Zapfentypen am seltensten vorkommt, besitzt ein Absorptionsmaximum von ungefähr 450 nm. Stäbchen hingegen reagieren vor allem auf kurzwelliges, blaues Licht. Auf Grundlage dessen verschiebt sich die Empfindlichkeit der Netzhaut bei Dunkelheit in die Richtung des kurzwelligen Lichtes. Der Purkinje-Effekt wird in der Praxis beispielsweise in der Beleuchtung von Fahrzeugamaturen verwendet. In diesem Zusammenhang kommt rotes Licht zum Einsatz, da es die Dunkeladaption des Auges erhält und trotzdem ausreichend Helligkeit bietet, um die Umgebung weiterhin wahrzunehmen. Auch bei astronomischen Beobachtungen wie dem Lesen von Sternenkarten oder Notizen findet dieser Effekt Anwendung. Schwaches Rotlicht wird hierfür genutzt, da das langwellige Licht primär Sinneszellen für das Sehen am Tage anspricht und das Nachtsehen nur gering beeinflusst, sodass die Empfindlichkeit beibehalten bleibt. Um das Sehen bei dunkleren Lichtbedingungen aufrechtzuerhalten, sind Lichtquellen mit hellem Weißlicht zu vermeiden.
Dunkelheit als Herausforderung
Der Begriff „Dämmerungssehschärfe“ kann leicht missverstanden werden, da er nicht die klassische Sehschärfe meint. Vielmehr beschreibt er die Fähigkeit des Auges, bei schwachem Licht Kontraste zu erkennen – ein Zusammenspiel aus Kontrastempfindlichkeit und Sehvermögen in der sogenannten mesopischen Phase. Für augenoptisches Fachpersonal ist dies besonders relevant, wenn es um die Beurteilung der Sehqualität unter realitätsnahen Bedingungen wie Dämmerung, Regen oder Nebel geht. Ein Verfahren ist die Adaptometrie, die die Anpassung des Auges an wechselnde Lichtverhältnisse misst – also die Hell-Dunkel-Adaptation. Die Nyktometrie konzentriert sich auf der anderen Seite auf das funktionale Sehen bei reduzierter Beleuchtung und ergänzt damit die klassische Refraktionsbestimmung sinnvoll. Die Messung erfolgt in der Regel mit einem Mesoptometer oder Nyktometer, die standardisierte Lichtverhältnisse und Blendquellen simulieren. Ergänzend kann eine Kontrast- oder Blendempfindlichkeitsprüfung sinnvoll sein.
Ein häufiges Phänomen, welches bei der Nyktometrie auffällt, ist die sogenannte Nachtmyopie: eine Kurzsichtigkeit bei Dunkelheit, die durch fehlerhafte Akkommodation entsteht. Sie lässt sich meist gut mit speziellen Brillengläsern oder Kontaktlinsen korrigieren. Typische Beschwerden, bei denen eine nyktometrische Untersuchung sinnvoll ist, sind z.B. erhöhte Blendempfindlichkeit, Unsicherheiten beim Autofahren bei Nacht oder subjektiv schlechtes Sehen trotz gutem Visus. Auch Beschwerden beim Gehen im Dunkeln oder beim Treppensteigen können Hinweise geben. Darüber hinaus liefert die Nyktometrie wichtige Hinweise auf mögliche Ursachen wie Retinitis pigmentosa, Veränderungen durch Medikamente oder auch neuronale Störungen – etwa nach einem Schädel-Hirn-Trauma oder einem Schlaganfall. Ein Vitamin-A-Mangel kann ebenfalls zu Nachtblindheit führen: In einem bekannten Experiment von Hecht und Mandelbaum (1940) konnte eine Versuchsperson nach 57 Tagen ohne Vitamin A kein Rhodopsin mehr bilden – das Sehen im Dunkeln war vollständig ausgefallen. Erst nach Gabe von Vitamin A funktionierten die Stäbchen wieder normal. Neben der bereits genannten Gesundheit der Augen haben auch die Dunkeladaption sowie das Alter einen Einfluss auf das Sehen in der Dämmerung. Mit steigendem Alter nimmt die Sensitivität der für das Nachtsehen zuständigen Stäbchen ab, was wiederum einen Einfluss auf die Sehleistung hat.
Durch die frühzeitige Erkennung von Einschränkungen im Dämmerungssehen lassen sich gezielte Empfehlungen aussprechen – etwa zur Wahl kontraststeigernder Brillengläser oder zur Überweisung an den Augenarzt bei Verdacht auf pathologische Ursachen. Besonders bei der Beurteilung der Fahrtauglichkeit bei Nacht ist die Nyktometrie ein wertvolles Instrument, das über die klassische Refraktion hinausgeht und sowohl die Lebensqualität als auch die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern kann.
Sicher unterwegs in der dunklen Zeit
Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, im Straßenverkehr gut zu sehen und gesehen zu werden. Für Fußgänger gilt: Helle Kleidung erhöht die Sichtbarkeit, noch besser sind reflektierende Elemente. Reflektoren leuchten, wenn Licht auf sie fällt, und machen sie für Autofahrer deutlich besser erkennbar. Praktisch sind Mützen, Schuhe oder Bänder mit reflektierenden Flächen – kleine Maßnahmen mit großer Wirkung. Auch Radfahrer sollten auf gute Sichtbarkeit achten. Zusätzlich werden Reflektoren an Helm, Kleidung oder Fahrradteilen empfohlen. Wichtig ist, dass diese nicht blenden, sondern gezielt die Sichtbarkeit erhöhen.
Für Autofahrer ist gutes Sehen ebenso entscheidend. Lassen Sie regelmäßig Ihre Sehleistung überprüfen. Achten Sie außerdem auf saubere Scheiben, funktionierende Lichter und intakte Bremsen. Motorradfahrer sollten zusätzlich für ein sauberes Visier sorgen, um bei Dunkelheit klar sehen zu können. Auch Betriebe können zur Verkehrssicherheit beitragen, etwa durch Informationsangebote oder Fahrsicherheitstrainings für Mitarbeitende. Unterstützung bieten unter anderem der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), der ADAC sowie Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.
Visuelle Anpassung zwischen Tag und Nacht
In der Dämmerung muss das menschliche Auge vom farbintensiven Tagessehen (Zapfen) auf das lichtempfindliche Nachtsehen (Stäbchen) umschalten. Dabei sinkt die Sehschärfe, Farben verblassen, und Kontraste gewinnen an Bedeutung. Der sogenannte Purkinje-Effekt erklärt uns, warum Blau heller und Rot dunkler erscheint. Die Anpassung an Dunkelheit erfolgt in zwei Phasen: Zunächst reagieren die Zapfen schnell, später übernehmen die Stäbchen – Farben erscheinen dann grau. Dieser Prozess dauert bis zu 30 Minuten. Mit zunehmendem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit der Stäbchen ab. Für Augenoptiker sind Verfahren wie Adaptometrie und Nyktometrie wichtig, um das Sehen bei schwachem Licht zu beurteilen – etwa bei Nachtmyopie, Blendempfindlichkeit oder unsicherem Sehen im Straßenverkehr. Frühzeitige Tests ermöglichen gezielte Empfehlungen, z.B. kontraststeigernde Brillengläser oder Überweisungen bei Verdacht auf Erkrankungen. So lässt sich die Sicherheit – besonders im Straßenverkehr – deutlich verbessern.
Lena Petzold ist Master of Optometry, Ophthalmotechnology & Vision Science, sammelte Erfahrungen rund um das wissenschaftliche Arbeiten bei JenVis Research und ist nun Professional Affairs Consultant bei CooperVision.